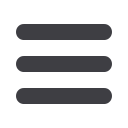
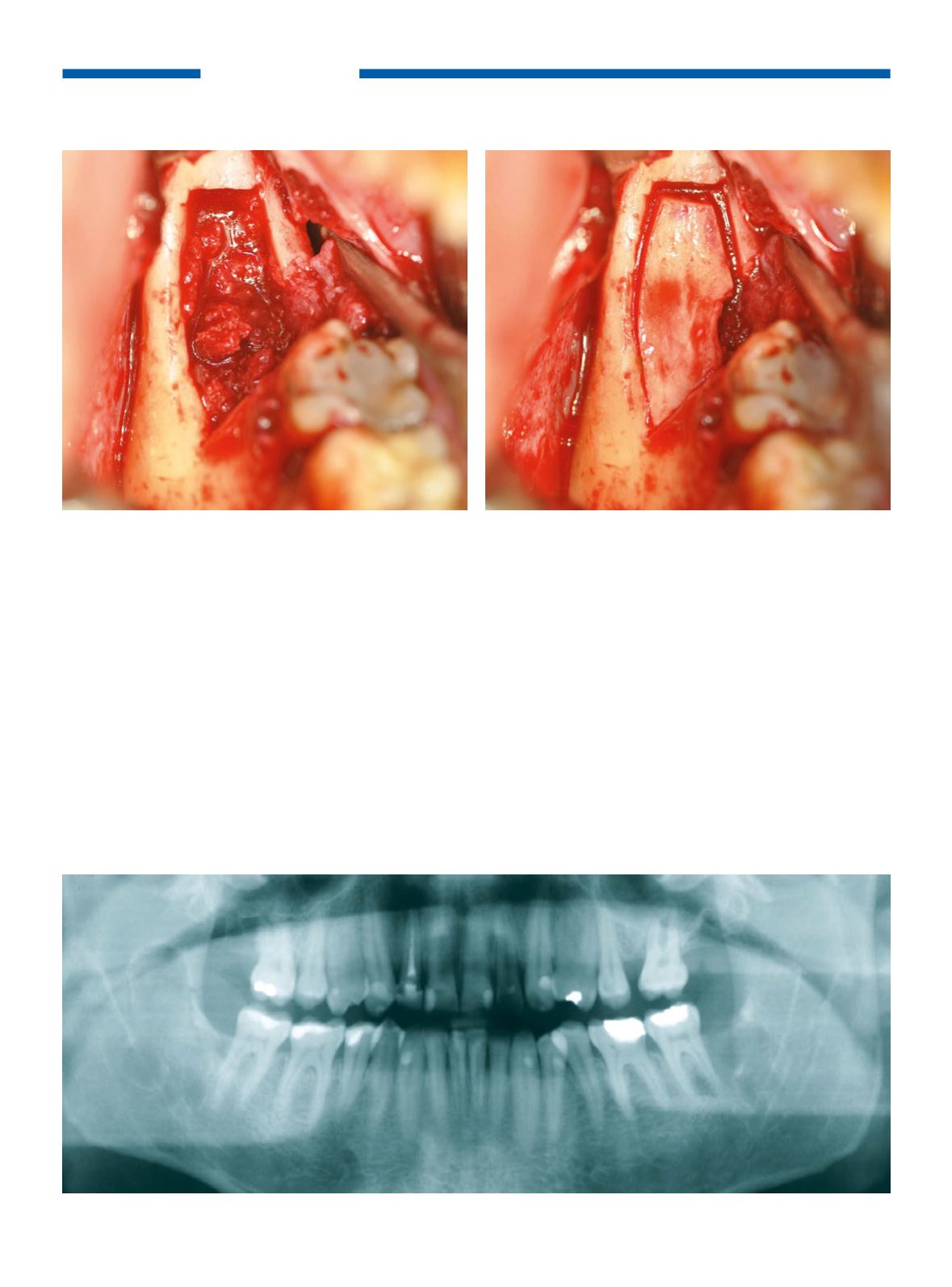
zm
107, Nr. 9, 1.5.2017, (1086)
Health Organisation wurde die OOC im
Jahr 2005 explizit von der Definition der
odontogenen Keratozysten ausgeschlossen,
zudem wurden diese nunmehr als KCOT
bezeichnet [Barnes, 2005].
Während sich beim OOC eine Orthokeratin-
schicht mit Hornschuppen und eine Granu-
lationszellschicht in unterschiedlicher Dicke
zeigen, bildet der KCOT eine wellenförmige,
parakeratinisierte Epithelschicht aus fünf
bis zehn Lagen sowie palisadenförmig auf-
gebaute Basalzellen [Mahdavi und Taghavi,
2017].
Orthokeratinisierte odontogene Zysten sind
selten, sie machen etwa zehn Prozent der
ursprünglich als keratozystisch odontogene
Tumoren klassifizierten Zysten aus [Dong et
al., 2010]. OOC können ausgedehnt auf-
treten und mit Schmerzen und Schwellun-
gen assoziiert sein, am häufigsten werden
sie jedoch als Zufallsbefund diagnostiziert
[Macdonald-Jankowski, 2010]. Sie kommen
vor allem im Unterkiefer vor und dort vor
allem im Bereich des dritten Molaren bezie-
hungsweise im aufsteigenden Ast – wie im
beschriebenen Fallbespiel [Li et al., 1998].
Etwa zwei Drittel der OOC haben direkten
Kontakt mit retinierten Zähnen [Macdonald-
Jankowski, 2010]. Die meisten dieser Zysten
treten bei Männern in der dritten oder in
der vierten Lebensdekade auf [Dong et al.,
2010]. Entscheidend für die Therapie-
planung ist die im Vergleich zum KCOT
(33,1 Prozent) deutlich geringere Rezidiv-
rate (null bis vier Prozent ) [Dong et al.,
2010; Macdonald-Jankowski, 2010; Gosau
et al., 2010]. Somit ist – wie im vorliegenden
Fall – zwar eine vollständige Entfernung der
Zyste, aber kein radikaleres Vorgehen indi-
Abbildung 5: nach Osteoplastik mit autogener Beckenkammspongiosa Abbildung 6: Als Verschluss wird der entnommene Knochendeckel
verwendet.
Abbildung 8: Postoperative Panoramaschichtaufnahme
52
Zahnmedizin


















