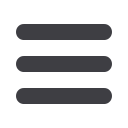
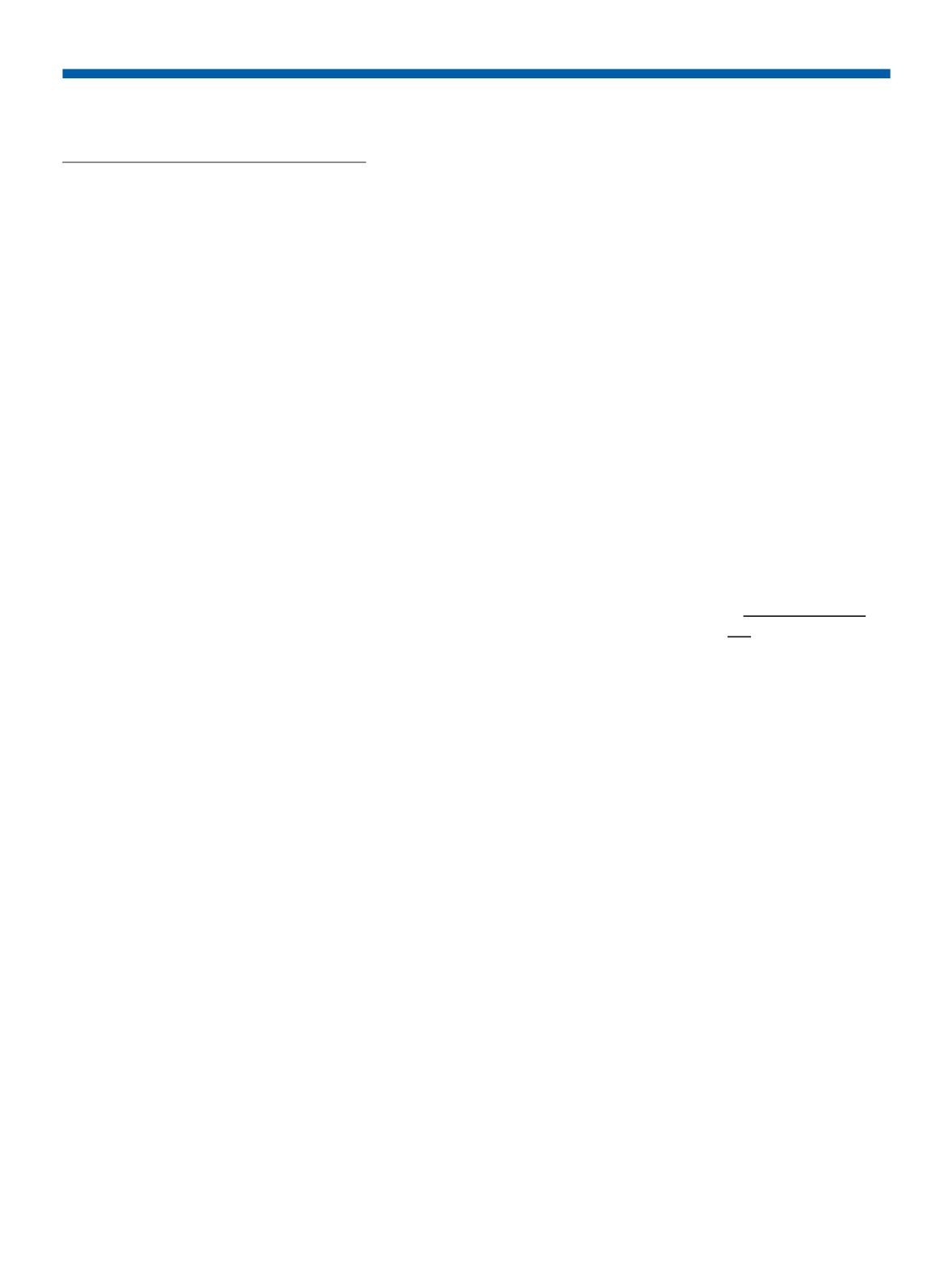
zm
107, Nr. 11, 1.6.2017, (1302)
Die Aufbereitung zahnärztlicher Instrumente
Die andere Sicht der Dinge
Der Ausschuss Praxisführung und Hygiene der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) und der Deutsche Arbeitskreis für Hygiene in der
Zahnmedizin (DAHZ) nehmen hier zu dem Artikel „Die Aufbereitung
zahnärztlicher Instrumente: Eine Geschichte von Ungereimtheiten
und Widersprüchen“ von Prof. Dr. Dr. Hans Jörg Staehle in den Zahn-
ärztlichen Mitteilungen [zm 7/2017, S. 76–87] Stellung:
Beim Lesen des Artikels entsteht der Eindruck, dass die Wertigkeit der
bewährten Desinfektionsverfahren falsch eingeschätzt wird. Eine voll
viruzide, chemische Desinfektion oder eine thermische Desinfektion
im RDG oder im Autoklaven versetzt Instrumente in einen Zustand,
dass sie bei einer weiteren Verwendung nicht mehr infizieren können.
Vegetative Bakterien werden bei chemischen Desinfektionsverfahren
mindestens um fünf Log-Stufen reduziert.
Bei thermischen Desinfektionsverfahren beträgt die logarithmische
Abtötungszeit (D-Wert) des thermoresistentesten pathogenen Bakte-
riums Enterococcus faecium bei 75
0
C etwa 0,07 Minuten [Pisot et
al., 2011]. Daraus lässt sich berechnen, dass bei dem in Thermo-
desinfektoren notwendigen A0-Wert von 3000 eine Inaktivierung
von mehr als 10
100
Enterococcus faecium erfolgt. Die genannten
Desinfektionsverfahren sind in der Lage, auch mit Hepatitis- oder mit
HI-Viren kontaminierte Instrumente sicher aufzubereiten.
Eine Sterilisation ist nur erforderlich, wenn zusätzlich Sporen ab-
getötet werden müssen. Dies betrifft Wundbrand, Milzbrand oder
Tetanus, also Krankheitserreger, die in der zahnmedizinischen
Infektiologie nicht relevant sind. Die genannten Erreger sind obligat
anaerob und wären daher nur dann von Bedeutung, wenn ein
speicheldichter Wundverschluss durchgeführt wird. Aus diesem
Grund ist es schlüssig, dass die RKI-Empfehlung 2006 besondere
hygienische Anforderungen nur für Eingriffe mit speicheldichtem
Wundverschluss fordert. Sterile Instrumente ergeben nur einen Sinn,
wenn auch ansonsten konsequent auf Sterilität geachtet wird. Dazu
gehören auch sterile Handschuhe und sterile Spüllösungen.
Selbstverständlich sind die Beobachtungen des Autors richtig, dass
bei restaurativen und prothetischen Behandlungen mit derzeit als
semikritisch eingestuften Instrumenten die Mundschleimhaut ver-
letzt oder Schleimhautverletzungen berührt werden können. Im
Gegensatz zu den Aussagen im Artikel stellt dies nach der Definition
der KRINKO aber keinen Grund dar, diese zu sterilisieren. In der
Empfehlung der KRINKO zu den „Anforderungen an die Hygiene
bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ [2012] sind kritische
Instrumente als solche definiert, „… die bestimmungsgemäß die
Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit
Blut […] kommen“. Das trifft auf Mundspiegel oder Übertragungs-
instrumente und rotierende oder oszillierende Instrumente bei
restaurativen und prothetischen Behandlungen sicher nicht zu.
Wir sehen hier keinerlei Abweichung von den gegenwärtigen
Empfehlungen der KRINKO. Natürlich ist es schwierig, die von der
KRINKO benutzte „Spaulding-Klassifikation“ [Spaulding, 1972] in un-
kritische, semikritische und kritische Medizinprodukte auf das Gebiet
zahnärztlicher Behandlungen anzuwenden. Das Problem haben aber
andere medizinische Fachdisziplinen auch. Beispielsweise wird eine
perkutane endoskopische Gastrostomie unter Verwendung eines
als „semikritisch B“ eingestuften (desinfizierten) Gastroskops, aber
mit weiteren als „kritisch B“ eingestuften (sterilen) Instrumenten
durchgeführt.
Vergleichende klinische Untersuchungen mit desinfizierten oder
sterilisierten Instrumenten zum Thema des Infektionsrisikos bei
restaurativen oder prothetischen Behandlungen fehlen. Das liegt
sicherlich daran, dass bei diesen Prozeduren seit vielen Jahrzehnten
mit desinfizierten Instrumenten gearbeitet wird und postoperative
Wundinfektionen nicht bekannt sind. Das wird durch eine aktuelle
Publikation bestärkt [Brewer et al., 2016]. Dort wurde selbst bei
zahnärztlich-chirurgischen wie auch bei dermatologischen Eingriffen
kein Unterschied in der Rate der Wundinfektionen gefunden, wenn
mit unsterilen Handschuhen und damit möglicherweise mit
durch diese kontaminierten Instrumenten gearbeitet wurde. Dem
im Staehle-Artikel formulierten Postulat, bei restaurativen oder pro-
thetischen oder im Zweifelsfall bei allen zahnmedizinischen Unter-
suchungen und Behandlungen besser sterile Instrumente zu ver-
wenden, können wir daher nicht folgen.
In seinem Beitrag „Eine Geschichte von Ungereimtheiten und Widersprüchen zur Instrumenten-
desinfektion“ diskutiert Prof. Hans Jörg Staehle in den zm 9, ob zahnärztliche Instrumente
sterilisiert oder desinfiziert werden müssen. Möglicherweise im Hinblick auf die in der Zahn-
heilkunde traditionell angewandte Dampfdesinfektion (=Sterilisation) und früher übliche
Arbeitsabläufe in seiner Arbeitsstätte postuliert der Autor, dass die Sterilisation ein höheres
Maß an Sicherheit gewähre und damit auch für restauratives Instrumentarium notwendig sei.
Von diesem Standpunkt leitet Prof. Staehle eine Rechtsunsicherheit für aufbereitende Zahn-
ärzte und einen Überarbeitungsbedarf der KRINKO-Empfehlungen zur Risikoeinstufung ab.
Der Ausschuss Praxisführung und Hygiene der Bundeszahnärztekammer und der Deutsche
Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnmedizin widerlegen unter Verweis auf die wissenschaft-
lichen Grundlagen der Aufbereitungsverfahren die Aussagen des Autors.
12


















