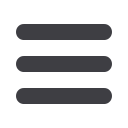
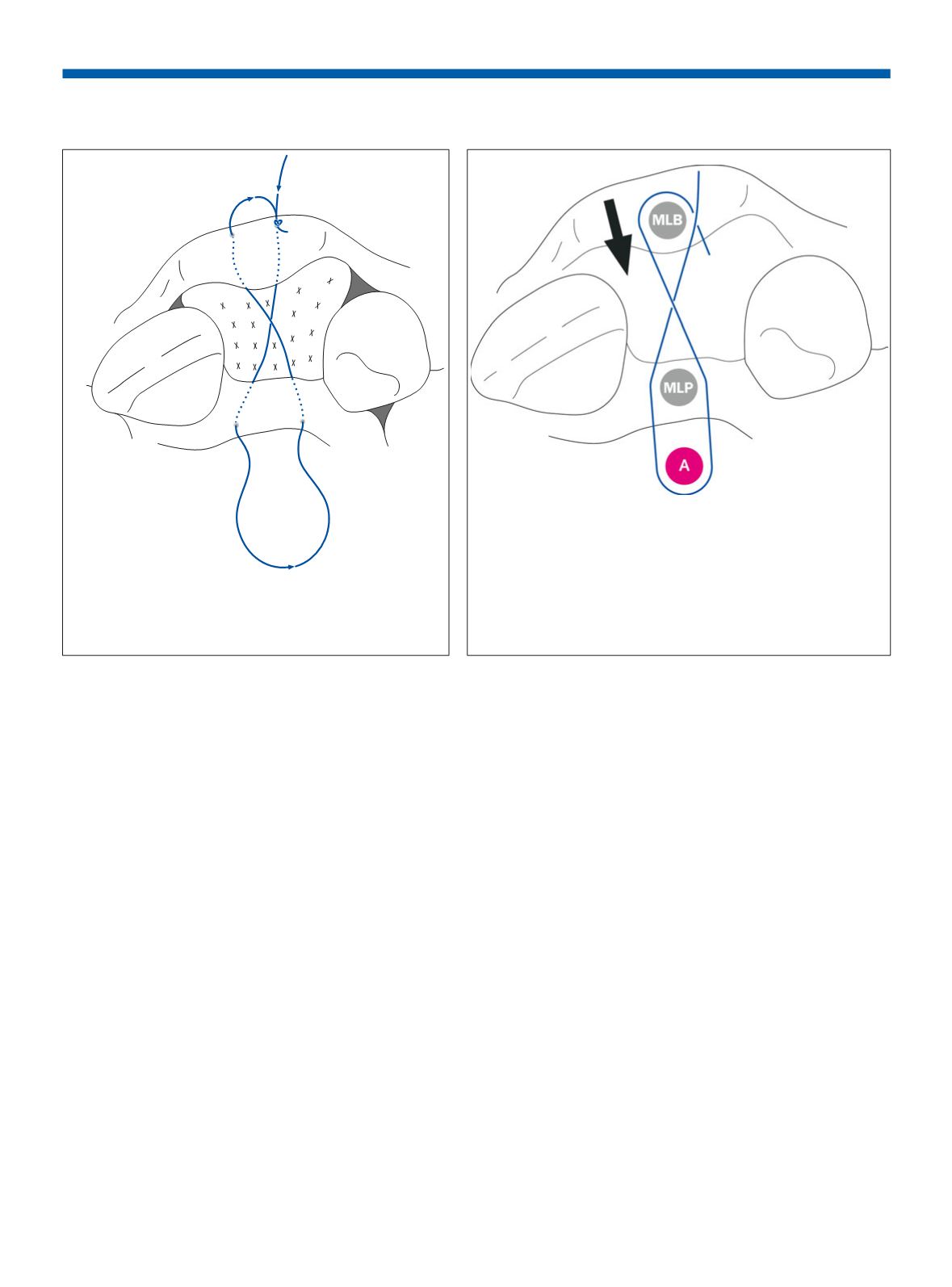
zm
107, Nr. 11, 1.6.2017, (1373)
Ankern für die Naht zur Erzielung einer best-
möglichen Wundstabilisierung geprägt.
Als solche Anker können natürliche Struk-
turen wie beispielsweise die Zähne, die
Gingiva, die mastikatorische Mukosa des
Gaumens oder das Periost dienen. Es kom-
men aber auch künstliche, beispielsweise
aus Composite angefertigte Retentionen
infrage.
Die Entlastungsnaht:
Entlastungsnähte
werden immer in Kombination mit Ver-
schlussnähten angewendet und etablieren
eine spannungsfreie Adaptation der Lappen-
enden bereits vor der Durchführung der
eigentlichen Verschlussnähte. Während Ver-
schlussnähte alleine eher zu einer punkt-
förmigen Lappenadaptation führen, resul-
tiert aus einer Kombination von Verschluss-
und Entlastungsnähten ein inniger und
flächiger Kontakt der Lappenenden. Die
Präzision und die mechanische Stabilität des
Nahtverschlusses werden erhöht, was insbe-
sondere von Bedeutung ist, wenn durch ein
größeres postoperatives Ödem eine erhöhte
Spannung der Lappenenden zu erwarten
oder das Wundgebiet während der post-
Quelle: Zuhr et al.
Abbildung 1: Schematische Darstellung einer horizontalen,
intern verlaufenden, gekreuzten Matratzennaht von okklusal
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Lappenstabilisierung
(Pfeil) durch eine horizontale, intern verlaufende, gekreuzte
Matratzennaht, wobei in diesem Fall die mastikatorische Mukosa
des Gaumens als Anker herangezogen wurde (MLB = mobiler
bukkaler Lappen, MLP = mobiler palatinaler Lappen, A = Anker)
Häufig verursachen nach dem Nahtver-
schluss zu stark auf die Lappen einwirkende
Zugkräfte, nicht präzise geknüpfte und sich
deshalb lösende Nähte oder durch eine
lokale Minderdurchblutung der Gewebe
hervorgerufene Nekrosen der Wundränder
einen sekundären Wundheilungsverlauf einer
zunächst primär verschlossenen Wunde
[Wikesjo/Nilveus, 1990]. Gerade im intra-
oralen Bereich sind solche Wunden in hohem
Maße einer bakteriellen Kontamination aus-
geliefert, die nicht selten die Grundlage für
kompromittierte Behandlungsergebnisse
mit Volumendefekten, fibrotischen Gewebe-
arealen und hypertrophischen Narbenbil-
dungen darstellen kann [Bhattacharya et al.,
2014].
Ein tief greifendes Verständnis für die Bedeu-
tung des Wundheilungsverlaufs hinsichtlich
der erfolgreichen Durchführung jeglicher
rekonstruktiv-chirurgischen Eingriffe sowie
die Identifizierung und Kontrolle der die
Wundheilung beeinflussenden Faktoren
bekommen vor diesem Hintergrund aus
klinischer Sicht eine elementare Wichtigkeit.
Im Rahmen der rekonstruktiven Parodontal-
und Implantatchirurgie sind es vor allem
technikbezogene Faktoren, die dem Behand-
ler die Möglichkeit geben, das Wundheilungs-
ergebnis unmittelbar positiv zu beeinflussen.
Der chirurgische Nahtverschluss spielt in
diesem Zusammenhang eine mitunter ent-
scheidende Rolle [Burkhardt/Lang, 2010].
Welchen Anker nehme ich
für die Naht?
Im Mittelpunkt der im Folgenden beschrie-
benen Auswahl häufig zur Anwendung
kommender Nahttechniken steht die immer
währende klinische Herausforderung, eine
möglichst stabile Wunde zu schaffen, ohne
dabei die Blutversorgung im Operations-
bereich wesentlich zu beeinträchtigen.
Offensichtlich ist, dass eine ausreichende
Stabilisierung der Wundränder kaum gelin-
gen kann, solange ausschließlich bewegliche
Lappenanteile in den Nahtverlauf einge-
bunden werden. Die Auswahl und Durch-
führung einer für die entsprechende kli-
nische Situation geeigneten Nahttechnik ist
deshalb wesentlich durch die Suche nach
83


















