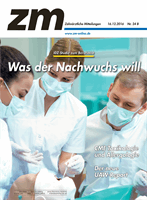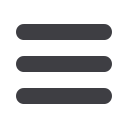

zm
106, Nr. 24 A, 16.12.2016, (1489)
B
Aufgrund der herstellungsbedingt geringen
mittleren Partikelgröße von etwa 14 µm wird
Erythritol für den supra- und subgingivalen
Einsatz empfohlen [Müller, Moëne, Cancela
& Mombelli, 2014b]. Erythritol ist nicht
kariogen, gut wasserlöslich und beeinflusst
nicht den Glukosespiegel. Derzeit wird es in
Verbindung mit Chlorhexidin (0,3 Prozent)
auf dem deutschen Markt vertrieben.
\
Trehalose:
Für die supra- und subgingivale
Reinigung wurde kürzlich ein weiteres
Süßungsmittel, die Trehalose, vorgestellt.
Dieses gut wasserlösliche Disaccharid ist
nicht kariogen und für Diabetiker geeignet
[Neta, Takada & Hirasawa, 2000; van Can,
van Loon, Brouns & Blaak, 2012]. Das Pulver
hat laut Herstellerangaben eine niedrige
mittlere Partikelgröße von etwa 30 µm und
eine geringere Abrasionstiefe als Glycin. Ihm
wird ebenfalls in geringen Mengen Silizium-
dioxid zugesetzt [Kruse et al., 2016].
\
Andere Pulverarten:
Auf dem Dental-
markt sind außer den bereits genannten
Pulversubstanzen auch Kalzium-Natrium-
Phosphosilikat, Aluminiumtrihydroxid und
Kalziumkarbonat erhältlich. Da diese jedoch
nicht wasserlöslich und zum Teil abrasiver
sind, werden sie nicht für den subgingivalen
Einsatz empfohlen und daher im vorliegen-
den Text nicht weiter ausgeführt [Petersilka,
2011; Graumann et al., 2013]
.
Effektivität
Derzeit gelten zur subgingivalen Biofilm-
entfernung während der anti-infektiösen
Therapie Handinstrumente und (Ultra-)
Schallgeräte als der Goldstandard. Die zeit-
intensivere Handinstrumentierung hinter-
lässt dabei möglicherweise eine glattere
Oberfläche [Drisko et al., 2000; Schmidlin,
Beuchat, Busslinger, Lehmann & Lutz, 2001],
während sich (Ultra-)Schallgeräte durch
besseres Handling und Erreichbarkeit von
Furkationseingängen und Einziehungen aus-
zeichnen. Häufig werden daher beide Ver-
fahren in Kombination verwendet. Die LPW-
Technik zeigt gegenüber der subgingivalen
Biofilmentfernung mit Handinstrumenten
und (Ultra-)Schall vergleichbare klinische
Ergebnisse. So konnten bei der Behandlung
mit Glycinpulver bei Sondierungstiefen von
drei bis fünf Millimetern ähnliche Ergebnisse
wie mit der Handinstrumentierung mit
Gracey-Küretten erzielt werden [Petersilka,
Tunkel, Barakos, et al., 2003]. In der paro-
dontalen Erhaltungstherapie brachte der
Vergleich zwischen Handinstrumentierung
beziehungsweise (Ultra-)Schall und sub-
gingivaler Anwendung von Glycinpulver,
Erythritol und Trehalose ebenfalls gleich-
wertige klinische Ergebnisse [Müller, Moëne;
Petersilka & Faggion CMJ, 2008; Wenn-
ström, Dahlén & Ramberg 2011; Cancela &
Mombelli, 2014a; Kruse et al., 2016].
Im Protokoll der Konsensus-Konferenz der
EuroPerio 2007 wurde der subgingivale Ein-
satz von LPW lediglich für die parodontale
Erhaltungstherapie empfohlen [Sculean et
al., 2013]. Auch die Autoren verschiedener
Anwendungsuntersuchungen unterstützen
die Aussage, dass LPW nicht zur Entfernung
von Zahnstein und Konkrementen geeignet
ist [Petersilka, Steinmann, Häberlein, Hein-
ecke & Flemmig, 2003; Petersilka, Tunkel,
Barakos et al., 2003; Moëne, Décaillet, An-
dersen & Mombelli, 2010]. Die Effektivität
zur Entfernung des Biofilms auf Implantat-
oberflächen scheint ebenfalls gleichwertig
gegenüber konventionellen Methoden zu
sein [Louropoulou, Slot & Van der Weijden,
2014]. Auch aufgrund einer vergleichbaren
Reduktion von Entzündungszeichen (Blutung
und Suppuration) sieht der Einsatz von LPW
in der Periimplantitistherapie sehr vielver-
sprechend aus [Schwarz, Becker & Renvert,
2015].
Patientenakzeptanz
Die zahnärztliche Behandlung mit LPW
wurde von Patienten in vielen Studien als
angenehmer bewertet als konventionelle
Verfahren. In einer aktuellen Übersichts-
Abbildung 2: Mithilfe spezieller Düsenansätze ist es unter
Verwendung niedrigabrasiver Strahlmittel möglich, eine
Biofilmentfernung auch in Taschen tiefer als 5 mm zu
bewerkstelligen.
Abbildung 3: Subgingivales Pulverstrahlen am Zahn: Um ein optimales Ergebnis zu
erzielen, sollte die Düse im Abstand von etwa 5 mm unter ständiger Bewegung etwa
parallel zur Zahnachse gehalten werden.
23