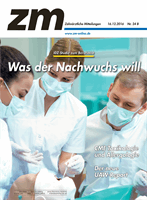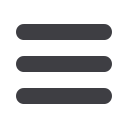
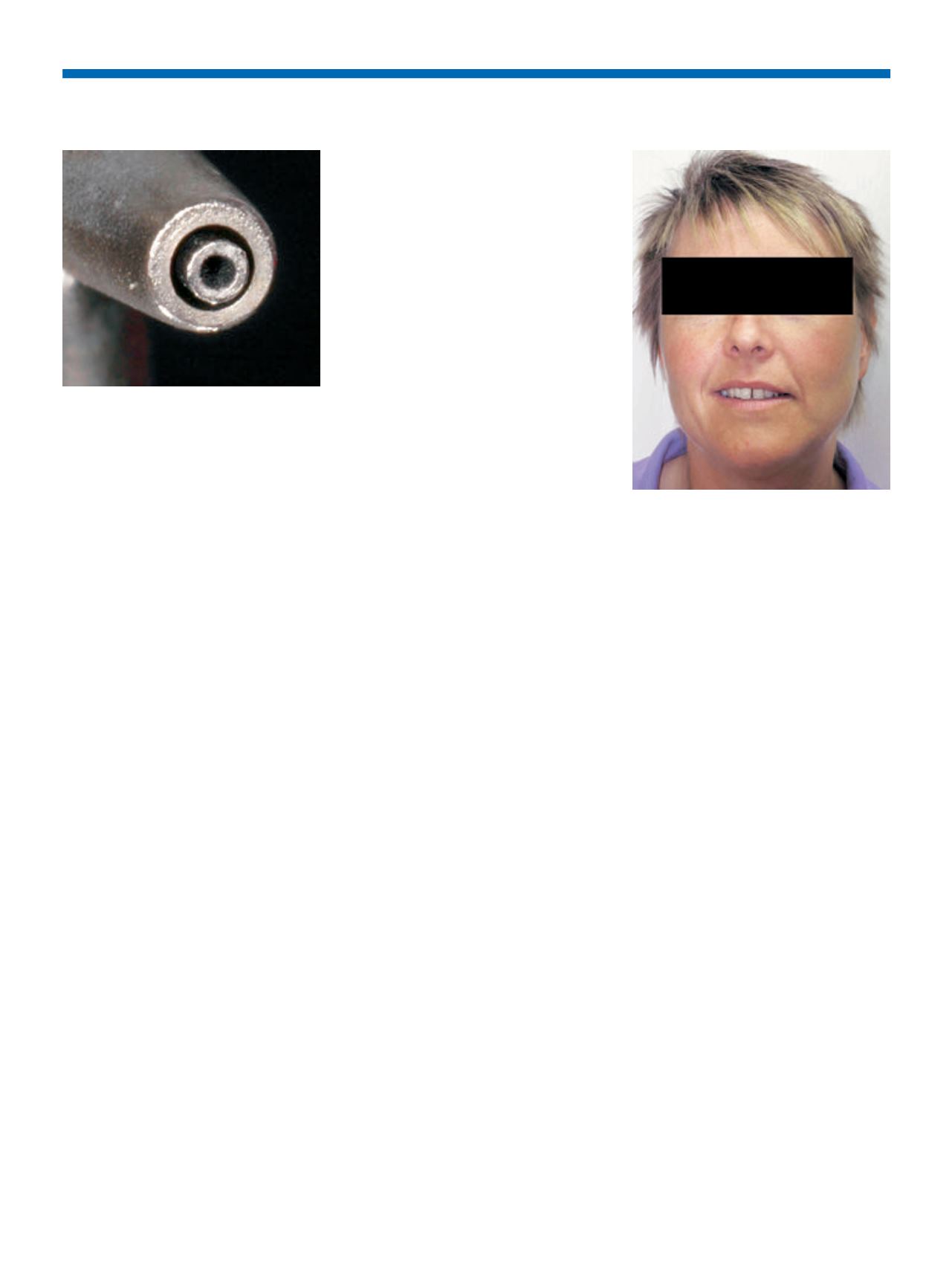
zm
106, Nr. 24 A, 16.12.2016, (1491)
B
Abrasionswerte auf Dentin- und Wurze-
loberflächen [Petersilka, Bell, Häberlein et
al., 2003, M. Pelka, Trautmann, Petschelt &
Lohbauer, 2010], Erythritol eine noch gerin-
gere Abrasivität [Müller et al., 2014b].
Daher sind diese beiden niedrig-abrasiven
Pulver für die subgingivale Anwendung
und auf freiliegenden Dentinoberflächen
empfehlenswert. Die Anwendung der
niedrig-abrasiven Pulver auf initialkariösen
Stellen ist derzeit noch nicht ausreichend
untersucht und daher auch kritisch zu sehen
[Masouleh, 2015].
Prinzipiell aber scheint der Einsatz von LPW
durch Verringerung des Substanzabtrags
[Petersilka et al., 2008] und der hinterlasse-
nen geringen Rauigkeit [Lavigne, Nauman,
Munley & Suzuki, 1988; Hürzeler et al., 1998]
dem konventionellen Scaling mit Hand-
oder (Ultra-)Schallinstrumenten während
der Erhaltungstherapie überlegen zu sein.
Werden niedrig-abrasive Pulver verwendet,
ist eine nachfolgende Politur mit Paste
und Kelch möglich, aber nicht zwingend
erforderlich.
Schädigung der Ginigiva:
Bei Untersuchungen der gingivalen Strukturen
nach Behandlung durch LPW mit Natrium-
hydrogenkarbonat konnten gegenüber
Anwendungen mit Glycinpulver deutliche
Erosionen der Gingiva festgestellt werden
[Kontturi-Närhi, Markkanen & Markkanen,
1989; Petersilka, Bell, Häberlein et al., 2003;
Kozlovsky, Artzi, Nemcovsky & Hirshberg,
2005]. Dies scheint nicht zuletzt an Partikel-
form und -größe zu liegen [Petersilka,
2011]. Die gingivalen Verletzungen sind
jedoch offenbar wie auch nach der Hand-
instrumentierung innerhalb von bis zu 14
Tagen reversibel [Petersilka et al., 2008;
Petersilka, 2011]. Da jede Touchierung
von Weichgewebe mit Natriumhydrogen-
karbonat zu einer Verletzung führen kann,
sollte der Pulver-Wasserstrahl nur auf Zahn-
hartsubstanz appliziert werden. Um nicht
zuletzt auch Rezessionen vorzubeugen,
wird grundsätzlich von der Anwendung von
Natriumhydrogenkarbonat in gingivalen
Bereichen abgeraten [Petersilka, 2011].
Schädigung von dentalen Restaurationen:
Während für Natriumhydrogenkarbonat
das Risiko besteht, dentale Restaurations-
materialien wie Komposit, Adhäsive und
Keramikoberflächen oder aber kieferortho-
pädische Versiegeler und Brackets zu schädi-
gen, wird diese Gefahr durch Glycinpulver
als minimal angegeben [Engel, Jost-Brink-
mann, Spors, Mohammadian & Müller-
Hartwich, 2009; M. A. Pelka, Altmaier,
Petschelt & Lohbauer, 2010; Giacomelli et
al., 2011; Petersilka, 2011; Graumann et al.,
2013]. Für Erythritol und Trehalose werden
geringere Abrasionswerte als für Glycin von
den Herstellern angegeben.
Aufgrund der zuvor genannten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse ist daher ein
Einsatz von niedrig-abrasiven Pulverarten
auch bei dentalen Restaurationen oder
kieferorthopädischen Apparaturen ohne
größere unerwünschte Effekte möglich.
Eine Politur aufgrund der Behandlung mit
LPW und niedrig-abrasiven Pulvern scheint
verzichtbar zu sein.
Schädigung von Implantatoberflächen:
Die Behandlung mit Natriumhydrogenkar-
bonat führt zu einer erhöhten Rauigkeit auf
Implantatoberflächen [Cochis et al., 2013].
Bei der Verwendung von niedrig-abrasiven
Pulvern, wie Glycin, konnten jedoch mehrere
In-vitro-Untersuchungen zeigen, dass selbst
spezielle Implantatoberflächen (Titan-Plasma-
Sprayed (TPS) oder sand-blasted and
acid-etched (SLA)) in ihren Oberflächen-
eigenschaften wie Rauigkeit und Beschich-
tung nicht ausschlaggebend verändert
werden [Barnes, Fleming & Mueninghoff,
1991; Mengel, Buns, Mengel & Flores-de-
Jacoby, 1998; Schwarz, Ferrari, Popovski,
Hartig & Becker, 2009; Louropoulou et al.,
2014].
Allergien und
Unverträglichkeiten
Im Zusammenhang mit dem subgingivalen
Einsatz von Natriumhydrogenkarbonat,
Glycin, Erythritol und Trehalose sind bisher
nach Wissen der Autoren keine allergischen
Reaktionen beschrieben worden. Prinzipiell
sind jedoch Allergien, auch auf Zusatzstoffe
der einzelnen Pulverarten, nicht auszu-
schließen. Lediglich in Einzelfällen wurden
für Erythritol als Süßungsmittel in Lebens-
mitteln allergische Reaktionen beobachtet
[Hino, Kasai, Hattori & Kenjo, 2000;
Yunginger et al., 2001]. In seltenen Fällen
geben Patienten ein brennendes Gefühl an
der Gesichtshaut nach Pulverstrahltherapie
mit Glycinpulver an.
Abbildung 6: Makrofotografie einer Pulver-
strahldüsenöffnung unmittelbar nach deren
Anwendung. Bei genauer Betrachtung sind
neben den Charakteristika eines „Hohl-
körpers“ gemäß RKI Richtlinien Biofilm-
beziehungsweise Pulverrückstände sichtbar.
Eine korrekte Aufbereitung der Düse nach
jedem Patienten ist daher obligat.
Abbildung 7: Klinisches Bild einer Patientin
mit Luftemphysem im Bereich des Oberkiefers
rechts. Erkennbar ist die Raumforderung.
Klinische Zeichen eines Emphysems wären
Krepitationsknistern bei Palpation und ggf.
Verschieblichkeit der Raumforderung.
(Abbildung aus der Sammlung Panitz, veröffentlicht in Petersilka et al. 2010, mit freund-
licher Genehmigung des Quintessenzverlags, Berlin).
25