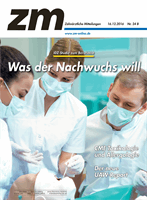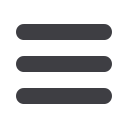

zm
106, Nr. 24 A, 16.12.2016, (1492)
B
Toxizität:
Natriumhydrogenkarbonat, Glycin, Erythri-
tol und Trehalose sind als Lebensmittel-
zusatzstoffe zugelassen und entsprechen
toxikologischen Richtlinien zum Einsatz in
der Mundhöhle als Medizinprodukt. In ein-
zelnen wissenschaftlichen Untersuchungen
wurden geringfügige gastro-intestinale Ne-
beneffekte wie Übelkeit, Blähungen oder
Durchfall beschrieben [European Food
Safety Authority, 2015; Bühler et al.,
2016b;]. Den Autoren ist keine Studie be-
züglich kanzerogener Effekte im Zusam-
menhang mit den genannten Substanzen
bei oraler Anwendung bekannt.
Bakteriämie:
Wie bei jeder subgingivalen Anwendung
dentaler Instrumente ist auch beim Einsatz
von LPW mit einer Bakteriämie zu rechnen
[Daly et al., 2001; Kinane et al., 2005]. In
einem direkten Vergleich wurde keine er-
höhte Bakteriämie verglichen mit einer
Politur mittels Polierkelch und Paste festge-
stellt [Hunter et al., 1989]. Daten zum Ver-
gleich der subgingivalen Anwendung mit
LPW und alternativen Verfahren in Bezug
auf Bakteriämien sind den Autoren nicht be-
kannt. Die Indikation für eine Endokarditis-
prophylaxe ist also nach derzeitigem Stand
nach denselben Maßstäben wie bei anderen
subgingivalen Behandlungen zu stellen
[Wilson et al., 2007].
Emphyseme
Eine sehr seltene Komplikation stellt die Ent-
wicklung eines Luftemphysems im Zusam-
menhang mit LPW dar. Als Symptom dafür
zeigt sich in der Regel innerhalb kürzester
Zeit nach Lufteintritt in das Gewebe eine
Raumforderung mit klassischen Krepitati-
onsgeräuschen beim Abtasten. Hierbei kann
die raumfordernde Schwellung sowohl
intra- als auch extraoral lokalisiert sein und
sich bis in die Hals-Nackenregion erstrecken.
Von 1977 bis 2001 wurden neun Fälle von
Luftemphysemen und drei Fälle von
Embolien dokumentiert [Flemmig et al.,
2007]. Bis 2013 beschrieben nur sechs
weitere Artikel ähnliche Vorkommnisse
[Graumann et al., 2013]. Der Einsatz
anderer zahnärztlicher Geräte wie Turbinen
und Luft-/Wasserspritzen, vor allem im Zuge
von Zahnextraktionen, führte jedoch in
der Vergangenheit wesentlich häufiger zu
vergleichbaren Komplikationen [Petersilka,
2011].
Das Risiko von Luftemphysemen scheint
insbesondere in Bereichen fehlender kerati-
nisierter Gingiva sowie stark entzündeter
Bereiche gegeben zu sein. Weiterhin erhöht
jede Verletzung der Integrität der Schleim-
haut das Emphysemrisiko. Hier ist beson-
dere Vorsicht geboten. Weiterhin wird emp-
fohlen, das Handstück bei jeglichem Einsatz
von LPW in ständiger Bewegung zu halten
[Petersilka, Panitz, Weresch, Eichinger &
Kern, 2010]. Alle bisher in der Literatur be-
schriebenen Fälle zeigten einen unproble-
matischen Verlauf bis zur Ausheilung bei
adäquater Behandlung. Dabei wurde beob-
achtet, dass die in das Gewebe eingebrachte
Luft sich ohne weitere Therapie innerhalb
von 24 bis 28 Stunden selbsttätig zurück-
resorbiert. Beim Auftreten eines Emphysems
sollte der Patient über das unerwünschte
Ereignis aufgeklärt werden und er sollte bei
unerwarteten potenziell problematischen
Verläufen die Möglichkeit haben, sofort
Kontakt zu seinem Behandler aufzunehmen.
Potenziell problematische Verläufe sind kar-
diopulmonale Symptomatiken beim Eintritt
von Luft über cervicofaciale Faszien sowie
Visusprobleme beim Eindringen von Luft
in den Orbitabereich. Weiterhin soll der
Patient einen intraoralen Luftdruckaufbau
wie zum Beispiel durch Niesen mit zugehal-
tenem Mund oder Nase, Valsalva-
Manöver oder Tätigkeiten wie das Spielen
von Blasinstrumenten unterlassen, um ein
erneutes Emphysem zu vermeiden. Die pro-
phylaktische Gabe eines Antibiotikums wird
kontrovers diskutiert und ist eventuell bei
immunologisch kompromittierten Patienten
(wie Diabetes Mellitus oder onkologischer
Therapie) denkbar [Bassetti, Bassetti, Scu-
lean & Salvi, 2014]. Bei fehlender Erfahrung
sollte man bei Verdacht auf ein Luftemphy-
sem die Überweisung an eine chirurgische
Praxis oder Klinik zur weiteren Diagnostik
und Therapie erwägen.
Technische Probleme
Es gibt Erfahrungsberichte über technische
Probleme aufgrund unsachgemäßer Bedie-
nung von Handstücken und LPW-Geräten,
bei denen es zu Verletzungen von Behandler
und/oder Patienten kam. Hierzu liegen
jedoch bisher keine wissenschaftlichen Da-
ten vor. In diesem Zusammenhang scheint
es umso wichtiger, bei der Behandlung die
Augen des Patienten zu schützen (durch
Schutzbrillen oder Schließen der Augen)
und auf Behandlerseite auch auf korrekten
Arbeitsschutz zu achten sowie die Geräte nur
bei entsprechender Sachkunde und unter
regelmäßiger Wartung zu verwenden.
Jedes unerwünschte Ereignis unter Verwen-
dung von LPW-Technik sollte, unabhängig
vom verwendeten Gerätetyp oder Strahl-
mittel, an das Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte gemeldet werden,
um allen Anwendern ein risikoarmes
Arbeiten zu erleichtern. Die Meldung kann
online unter
www.bfarm.deerfolgen, das
Formular ist auch auf
zm-online.dezum
Download erhältlich.
Fazit
Die Anwendung von LPW ist in der
modernen zahnärztlichen Praxis nicht mehr
wegzudenken. Zeitersparnis und Patienten-
akzeptanz machen dieses Verfahren attrak-
tiv für den täglichen Einsatz. Insbesondere
in der parodontalen Erhaltungstherapie
bietet LPW in Verbindung mit niedrig-
abrasiven Pulvern gegenüber der subgingi-
valen Reinigung mit (Ultra-)Schall und
Handinstrumenten viele Vorteile sowohl
für den Behandler als auch den Patienten
bei gleicher Effektivität. Dennoch sollten
Kontraindikationen und Risiken bei jedem
Einsatz berücksichtigt und mit dem Patient
besprochen werden. Bei korrekter Anwen-
dung kann der subgingivale Einsatz von
LPW grundsätzlich als sicher erachtet wer-
den. Jedoch sind Überempfindlichkeitsreak-
tionen auf einzelne Substanzen beim Einsatz
in der Mundhöhle oder seltene Fälle einer
Emphysembildung niemals gänzlich auszu-
schließen.
26
Fortbildung: Toxikologie und Allergologie