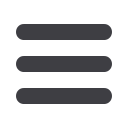
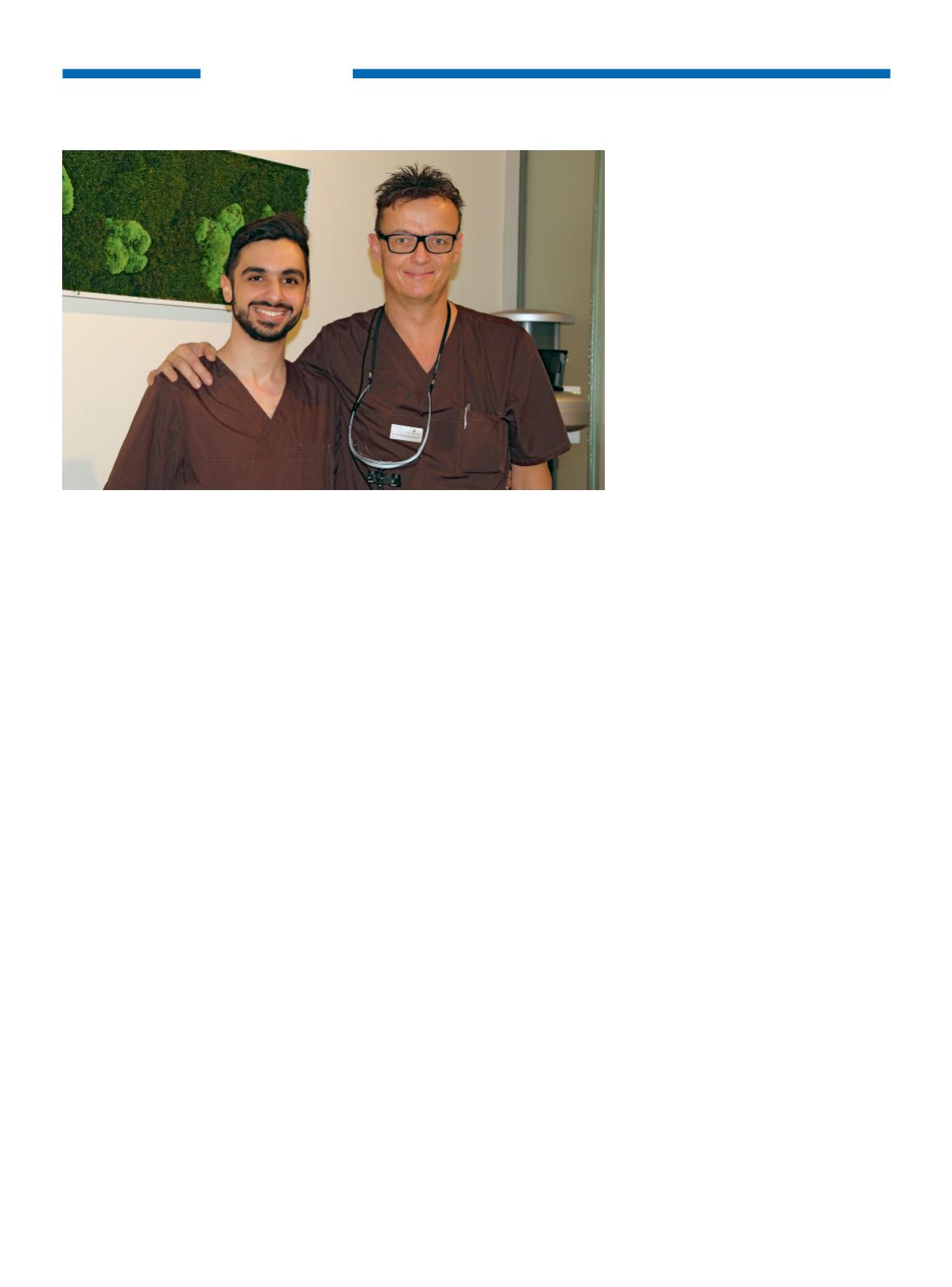
zm
107, Nr. 2, 16.1.2017, (110)
Was das Lernen von Fremdsprachen betrifft,
verlasse ich mich nicht so sehr auf Bücher
oder Kurse. Sprache ist Kommunikation
zwischen Menschen – man muss die Alltags-
sprache kennen, um Sprache zu benutzen.
Ich habe mich also darauf konzentriert, wie
die Deutschen sprechen, und nicht darauf,
was in einem Buch steht. Viele denken daher
wohl auch, dass ich schon viel länger in
Deutschland lebe.
Mein Praktikum hat mir natürlich auch sehr
geholfen, Deutsch zu lernen. Zusätzlich
habe ich auch noch einen Drei-Wochen-
Kurs gemacht – aber ich sage mal so: Der
Kurs hilft, aber dennoch muss man selbst
lernen. Ich gehe gerne in die Bibliothek und
bin dann tatsächlich jeden Tag für fünf,
sechs, sogar manchmal sieben Stunden dort
gewesen und habe Fachbücher gelesen.
Und – wie man jetzt hört – es hat funk-
tioniert und mein Deutsch ist schnell viel
besser geworden.
Die Prüfung war dann eigentlich okay –
nicht so leicht, aber auch nicht so schwer.
Aber ich kann halt nur von mir sprechen
und nicht von mir auf andere Kollegen
schließen. Bei mir lief es wirklich gut. Ich
hatte wirklich nette Prüferinnen, die mir ein
gutes Gefühl gegeben haben – das verleiht
einem zusätzliche Sicherheit.
Ob eine Fachsprachprüfung überhaupt
nötig ist: Ja, auf jeden Fall, sage ich! Der
Schlüssel in Deutschland ist die Sprache –
vor allem in unserem Bereich. Wir müssen
den ganzen Tag mit den Patienten reden –
die ganze Zeit. Wenn ich Informatiker wäre,
wäre das vielleicht nicht notwendig, aber
bei uns muss der Patient ja das Gefühl
haben, dass der uns vertrauen kann und das
bekommt er, wenn man mit ihm spricht und
ihm ständig jeden einzelnen Behandlungs-
schritt erklärt.
?
Sie haben die Fachsprachprüfung dann
im Juli abgelegt – Ihre Aufenthalts-
erlaubnis endete im August. Wie ist es
weitergegangen?
Es war schon alles sehr knapp – denn jetzt
musste das LAGeSo meine Unterlagen ja
noch bearbeiten. Und so konnte ich schon
wieder nur warten. Ich bin also wieder zu
der Dame gegangen und sagte, es sei
dringend, mein Aufenthalt ist bald zu Ende
und so weiter. Mir wurde dann gesagt, ich
müsste eine Stelle haben, um das Verfahren
zu beschleunigen. Nur so hätte ich eine
Chance, in Deutschland bleiben zu können.
Ich hatte nun also drei Wochen Zeit, eine
Stelle zu finden – sonst hätte ich ausreisen
müssen.
?
Ganz schön viel Druck. Wie sind Sie
vorgegangen?
Ich habe mich natürlich überall beworben –
persönlich, telefonisch, per Mail und über
die Stellenbörse der Kammer. Und ich wollte
nun auch unbedingt bei einem deutschen
Zahnarzt arbeiten, damit ich mein Deutsch
noch verbessern kann. Ich hatte das Gefühl,
dass ich das schaffen kann – und richtig mit
deutschen Patienten umgehen kann. Leider
hatte ich nicht so viele Vorstellungsgespräche
– um ehrlich zu sein nur drei, obwohl
ich mindestens 35 Bewerbungen verschickt
habe – und dazu noch die ganzen Anrufe.
Es ist in Berlin wirklich sehr schwer, als Assis-
tenzzahnarzt eine Stelle zu finden. Ich mag
Berlin sehr gerne, aber wenn ich die Zeit
zurückdrehen könnte, hätte ich mich für
eine andere Stadt entschieden.
?
Ihren jetzigen Chef aus der Praxis in
Kreuzberg haben Sie dann auf ziem-
lich ungewöhnliche Weise kennenge-
lernt. Wie kam es dazu?
Ich habe von dem Freund einer Freundin
die E-Mail meines jetzigen Chefs bekom-
men. Ich habe ihn kontaktiert und er war
direkt abends zu einem Treffen bereit. Ich
sollte zu einer Adresse kommen, die er mir
per SMS schickte. Ich habe diese gegoogelt
und es hat sich ergeben, dass es sich um
eine Shisha-Bar direkt am Mehringdamm
in der Nähe seiner Praxis handelte. Ich war
sehr verunsichert. Soll ich gehen? Oder lie-
ber nicht? Was soll‘s, dachte ich, ich hatte ja
sowieso nichts zu verlieren. Ich hätte in zwei
Wochen abgeschoben werden können. Also
bin ich da hingegangen.
In der Bar waren zu 90 Prozent Araber
und alle saßen auf Sofas – nur in der Mitte
stand ein Deutscher. Da hab‘ ich gedacht,
das müsste er sein. Also hab‘ ich ihn be-
grüßt. Er hat aber auf Arabisch geantwortet.
Ich dachte, okay, vielleicht kennt er ein
paar Wörter und habe weiter mit ihm
auf Deutsch geredet – aber er hat immer
auf Arabisch geantwortet, bis ich ihn
dann gefragt habe, „Sind Sie überhaupt
Deutscher?“, „Ich komme aus Bremen“ hat
er dann gesagt [lacht].
Das war schon lustig. Ich konnte mir halt
überhaupt nicht vorstellen, dass mein Vor-
Seinen Chef, Dr. Matthias Eigenbrodt (rechts), hat Al Shalak durch befreundete Kontakte in einer
Berliner Shisha-Bar kennengelernt. „Ich war sehr verunsichert. Soll ich gehen? Oder lieber nicht?
Aber was soll‘s, dachte ich, ich hatte ja sowieso nichts zu verlieren. Ich hätte in zwei Wochen
abgeschoben werden können“, erzählt Al Shalak. Dann stellte sich heraus: Dr. Eigenbrodt hat
lange in Jemen, im Libanon und in Jordanien gelebt und spricht daher perfekt Arabisch.
Foto: nh-zm
16
Gesellschaft


















