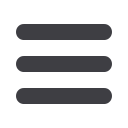

zm
107, Nr. 9, 1.5.2017, (1046)
Was soll das EU-Dienstleistungspaket?
Am 10. Januar 2017 stellte die EU-Kommis-
sion das sogenannte Dienstleistungspaket
vor, das sich mit den Vorschriften und Regle-
mentierungen von Freiberuflern beschäf-
tigt. Damit will die Kommission neue Impul-
se für den Dienstleistungssektor setzen, also
das Wirtschaftswachstum in Europa ankur-
beln. Dazu sollen bürokratische Hürden für
Unternehmer und Freiberufler abgebaut
werden – so sagt es die EU-Kommission
zumindest. Kritiker werfen ihr das genaue
Gegenteil vor.
Wie argumentiert die EU-Kommission?
Dienstleistungen machen etwa zwei Drittel
der Wirtschaftskraft der EU aus und schaffen
etwa 90 Prozent der neuen Arbeitsplätze.
Dennoch bleibe der Dienstleistungssektor
hinter seinen Möglichkeiten zurück. Mithilfe
des Dienstleistungspakets will die Kommissi-
on daher Dienstleistern helfen, administrati-
ve Hürden zu überwinden.
Mit welchen administrativen Hürden haben
Dienstleister zu kämpfen?
Ein Beispiel bringt es auf den Punkt: Ein
deutscher Dienstleister, der in Frankreich
vorübergehend einen oder mehrere Auf-
träge im Baubereich durchführen möchte,
ohne sich dort niederlassen zu wollen,
braucht momentan zwingend eine in Frank-
reich abgeschlossene Versicherung, um
gegen eine zehnjährige Gewährleistungs-
frist abgesichert zu sein.
Was beinhaltet das EU-Dienstleistungspaket?
Vier verschiedene Maßnahmen sind im
Dienstleistungspaket gebündelt, wobei nur
eine dieser Maßnahmen – ein sogenannter
Richtlinienvorschlag für eine Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung für nationale Vorschriften
für Freiberufler – für die Gesundheitsberufe
überhaupt relevant ist.
Warum will die EU-Kommission eine Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung einführen?
EU-Dienstleistungspaket
Das Paket, das keiner haben will
„Neue Übergriffe der EU-Kommission“, „Berufsrecht in Gefahr“, „Massiver Ein-
griff in die Selbstverwaltung“: Das neue Dienstleistungspaket der EU-Kommission
soll Wachstum bringen – aber erst einmal
erntet es herbe Kritik.
Mit der Verhältnismäßigkeitsprüfung will
die Kommission mehr Transparenz für Be-
rufsvorschriften schaffen: Die EU-Mitglied-
staaten sollen in Zukunft schon im Vorfeld
prüfen, ob neue oder geänderte nationale
Berufsvorschriften gerechtfertigt, notwen-
dig und verhältnismäßig sind. Ziel ist,
eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den
Mitgliedstaaten herzustellen.
Die Kommission listet elf Kriterien auf, die
im Zuge einer Verhältnismäßigkeitsprüfung
von den Mitgliedstaaten im Einzelnen zu
prüfen sind. Dazu gehören die Gefahrenge-
neigtheit einer Tätigkeit und deren Komple-
xität und die dafür erforderliche Berufsquali-
fikation. Zusätzlich sollen die kumulativen
Effekte bereits bestehender berufsrechtlicher
Vorgaben wie Fortbildungspflichten, Rechts-
erfordernisse, obligatorische Mitgliedschaf-
ten in Kammern und Verbänden analysiert
werden.
Aus gesundheitspolitischer Perspektive wird
diese Maßnahme massiv gerügt. Die Kritiker
sehen hier das Subsidiaritätsprinzip gefähr-
det, das darauf abzielt, dass eine übergeord-
nete Instanz nur dann regulierend, kontrol-
lierend oder helfend eingreift, wenn die klei-
nere Einheit dazu nicht der Lage ist.
Inwiefern wird das Subsidiaritätsprinzip ge-
fährdet?
Kritiker werfen der EU-Kommission Regu-
lierungswahn vor. In Deutschland werden
Berufsvorschriften bereits geprüft – durch
die Berufskammern, die Selbstverwaltung
sowie die Landes- und Bundesregierung –
und zwar verpflichtend auf Basis des Grund-
gesetzes und der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts beziehungsweise
des Europäischen Gerichtshofs. So dürfen
Berufsregeln niemanden aufgrund seiner
Staatsangehörigkeit oder seines Wohnsitzes
diskriminieren, sie müssen geeignet, ange-
messen und durch das Allgemeininteresse
Foto: brankospejs/VanReeel – Fotolia
12
Politik


















