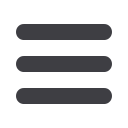

zm
107, Nr. 9, 1.5.2017, (1109)
einerseits die Weiterführung seines Lebens-
werks und andererseits den Wunsch, die
Patienten gut versorgt zu wissen und dabei
den Nachfolger zu unterstützen. Abgeber
möchten zudem vielfach nicht abrupt die
zahnärztliche Tätigkeit einstellen. Sie kann
mit einer gemeinsamen Zeit – auch mit fle-
xiblem Ende oder in sich vermindernder
Teilzeit – fortgesetzt werden, ohne dass der
Abgeber weiterhin die wirtschaftliche Ver-
antwortung der Praxis tragen muss. Schließ-
lich kann er auf diesem Weg am einfachsten
für noch von ihm abgerechnete Leistungen
Nacharbeiten oder Neuanfertigungen aus-
führen.
Die kalte Übergabe
Es gibt jedoch Konstellationen, in denen
eine warme Übergabe nicht von Interesse
ist. Dies betrifft Fälle, in denen der Über-
nehmer nur am Standort (etwa wegen einer
besonderen Lage) interessiert ist oder der
Abgeber seine zahnärztliche Tätigkeit nicht
mehr fortsetzen kann oder will. Manchmal
wird erkennbar, dass die Parteien einen
schlechten persönlichen Draht zueinander
haben. In solchen Fällen macht es wenig
Sinn, eine gemeinsame Praxiszeit durchzu-
führen.
Schwierigkeiten in der Praxis:
In der
alltäglichen Umsetzung zeigen sich mitun-
ter Probleme einer Zusammenarbeit.
So kann es für Abgeber
ein schwieriger Schritt
sein, die Stellung als
Chef aufzugeben und
die Rolle eines Angestell-
ten einzunehmen.
Umgekehrt kann die
Entwicklung des Über-
nehmers von einem An-
gestellten zu einem all-
verantwortlichen Chef
genauso schwierig sein.
Hier müssen beide
Seiten bereit sein, sich in
die jeweils neue Rolle
angemessen einzufin-
den und sich wechsel-
seitig zu unterstützen.
Im Idealfall werden die
neuen Rollen gemein-
sam dem Personal vermittelt. Gelingt dies
nicht, treten Reibereien auf, die bisweilen
nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch
dem Patientenstamm bekannt werden. In
diesem Fall hat die gemeinsame Zeit nicht
nur ihr Ziel verfehlt, sondern es ins Gegen-
teil verkehrt.
Fazit
Die größten Schwierigkeiten respektive
Argumente gegen eine gemeinsame Praxis-
zeit liegen in den persönlichen Strukturen
der Beteiligten und deren etwaiger Inkom-
patibilität. Da sich beide Seiten ihre Position
schon zu einem Zeitpunkt rechtsverbindlich
sichern wollen und müssen, an dem die
Phase der „warmen Hand“ noch nicht ein-
mal begonnen hat, ist es unerlässlich, ver-
tragliche Regelungen für den Fall des Schei-
terns zu treffen.
Beide Seiten müssen wissen, dass die
„warme Hand“ lediglich ein Versuch ist, die
immateriellen Praxiswerte optimal zu über-
tragen. Das klappt nicht immer. Zumeist
lohnt es sich aber, den Versuch anzugehen.
Wenn die warme Hand gelingt, stellt dies
meines Erachtens die ideale Umsetzung der
Praxisübergabe für den Abgeber, für den
Übernehmer und regelmäßig auch für die
Patienten dar.
Carsten Wiedey
Fachanwalt für Medizinrecht
www.arztanwalt.comFoto: zm-mg
Die Übernahme einer Einzelpraxis war
auch 2015 die favorisierte Form der Exis-
tenzgründung: Laut dem jüngsten Invest-
Monitor des Instituts der Deutschen
Zahnärzte (IDZ) entschieden sich 65
Prozent der zahnärztlichen Gründer für
diesen Weg in die Selbstständigkeit. Zum
Vergleich: Lediglich 7 Prozent gründeten
eine Einzelpraxis.
28 Prozent entfielen auf Neugründun-
gen, Übernahmen sowie Bei- oder Eintrit-
te in Berufsausübungsgemeinschaften.
Das durchschnittliche Investitionsvolu-
men für die Übernahme einer Einzelpraxis
belief sich 2015 auf 273.000 Euro plus
Betriebsmittelkredit von 53.000 Euro und
lag damit etwa auf dem Niveau der Vor-
jahresvergleichswerte von 265.000 bezie-
hungsweise 58.000 Euro.
Insgesamt wurden 2015 im Durchschnitt
124.000 Euro (2014: 110.000) für den
Goodwill und 48.000 Euro (2014:
53.000) für den Substanzwert aufgewen-
det. Die restlichen Positionen waren
Modernisierungs- und Umbaumaßnah-
men (6 Prozent), medizinisch-technische
Geräte und Einrichtung (18 Prozent),
sonstige Investitionen (7 Prozent) sowie
der Betriebsmittelkredit (16 Prozent).
Zahnärztinnen investierten bei ihren
Übernahmen deutlich weniger. Ihr Finan-
zierungsvolumen lag mit 290.000 Euro
inklusive Betriebsmitteln erheblich unter
dem Durchschnittsbetrag ihrer männli-
chen Kollegen (357.000 Euro).
Ungleich teurer als eine Übernahme ist
die Neugründung einer Einzelpraxis. Sie
kostete 2015 durchschnittlich 484.000
Euro. Die größte Position war hierbei die
Anschaffung von medizinisch-techni-
schen Geräten (59 Prozent). Jeweils 14
Prozent entfielen auf Modernisierungs-
und Umbaumaßnahmen sowie sonstige
Investitionen. Der Betriebsmittelkredit lag
durchschnittlich bei 63.000 Euro, was ei-
nem Anteil von 13 Prozent entsprach.
Für den InvestMonitor 2015 wurden vom
IDZ und von der Deutschen Apotheker-
und Ärztebank (apoBank) 521 im Jahr
2015 von der Bank abgewickelte Finan-
zierungsfälle ausgewertet. Die Studien-
autoren weisen darauf hin, dass es sich
bei den untersuchten Fällen weder um
eine repräsentative Stichprobe noch um
eine Vollerhebung handelt.
Aufgrund des hohen Marktanteils der
apoBank im Segment der zahnärztlichen
Existenzgründung ließen sich jedoch
zumindest für die alten Bundesländer ein-
geschränkt allgemeingültige Aussagen
treffen.
Aufgrund der geringen Zahl erfasster
Finanzierungsfälle sind für die neuen Bun-
desländern hingegen lediglich Trends-
aussagen möglich.
mg
Die Übernahme bleibt die häufigste Form der Gründung
75


















