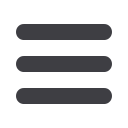
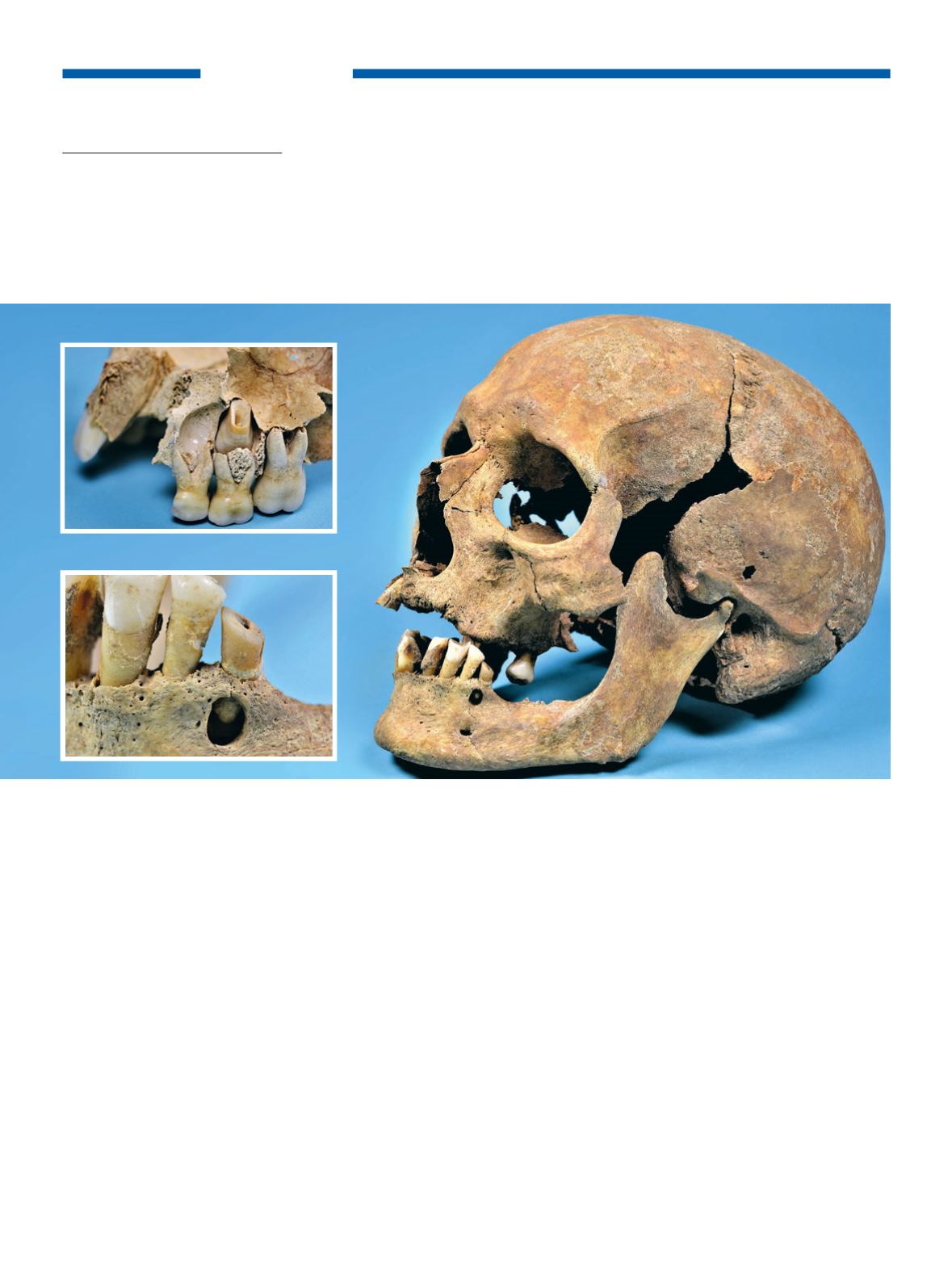
zm
107, Nr. 9, 1.5.2017, (1066)
Bei den gut 110 Individuen, deren Skelet-
treste im Verlauf der letzten 120 Jahre
bislang auf dem Klosterareal geborgen und
untersucht wurden, geben die Zähne mit
die besten Hinweise darauf, wie die Men-
schen damals gelebt haben:
Zahnerkrankungen zählen neben Abnut-
zungen an den Gelenkflächen – hier insbe-
sondere im Bereich der Wirbelsäule und im
Lendenwirbelbereich – zu den häufigsten
Krankheiten, die man anhand der Überreste
feststellen konnte.
Dabei zeigen die Zähne eine massive Zu-
nahme der Karies, nachdem die Menschen –
in Mitteleuropa ab etwa 5.500 vor Christus
– sesshaft wurden und ihre Ernährung auf
eine kohlehydratreiche Kost umstellten. Ein
weiterer, wenn auch in der Kulturgeschichte
stark variierender Faktor, ist die Mundhygie-
ne, die vor allem im Mittelalter und der frü-
hen Neuzeit kaum eine Rolle spielte. Die teil-
weise massiv auftretenden Konkremente
deuten auf fehlende Zahnpflege hin.
Seit 5.500 v. Chr. boomt Karies
Die Folge sind neben kariösen Defekten,
unter denen die meisten Männer und Frau-
en litten und die häufig den einzelnen Zahn
vollständig zerstörten, auch Parodonto-
patien, Entzündungen an der Wurzelspitze
(Zysten) oder sogar Abszesse, die wiederum
zu einer Zersetzung des Kieferknochens und
des Zahnhalteapparats führten. Gerade bei
Menschen über 40 ist demnach häufig ein
Zahnverlust dokumentiert, der vor allem die
Skelettfunde beim Kloster Lorsch
Was mittelalterliche Zähne erzählen
Rund 110 Skelettreste aus dem Mittelalter wurden in den vergangenen 120
Jahren auf dem Areal des Weltkulturerbes Kloster Lorsch in Hessen geborgen.
Eine Analyse der Zähne zeigt, wie die Menschen damals gelebt haben.
Die Überreste geben Aufschluss darüber, welches Alter der Mensch erreichte und an welchen Zahnkrankheiten er im Laufe seines Lebens gelitten hat
(oben: Zahndurchbruch, unten: Entzündung der Wurzelspitze).
Fotos: Kloster Lorsch
Molaren betrifft. Doch litten selbst junge
Menschen unter Zahnausfall.
Schmelzhypoplasien nähren den Ver-
dacht, dass einige Menschen im Kindesalter
zwischen eineinhalb und fünf Jahren unter-
versorgt gewesen sein müssen. Allerdings
sind die Gründe für diese Veränderungen im
Zahnschmelz vielfältig – sie reichen von
Mangelernährung bis hin zu Parasitenbefall
oder längeren Krankheitsphasen. Auch die
gelegentlich an kindlichen Skeletten fest-
stellbare siebartige Durchbrechung des
Dachs der Augenhöhlen, die sogenannte
Cribra orbitalia, kann nicht alleine auf
Eisenmangel zurückgeführt werden. Da
die Untersuchungen zeitaufwendig und
die Analysen noch nicht abgeschlossen
sind, können die Forscher weitere Aussa-
32
Gesellschaft


















