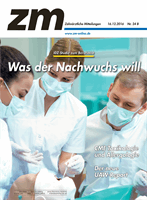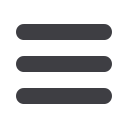

zm
106, Nr. 24 A, 16.12.2016, (1501)
B
sensiblen Ameloblasten [Bronckers et al.,
2009], nicht hingegen den menschlichen
Organismus an anderen Stellen. Daher
sollte die pharmakologisch korrekte Einord-
nung als chronisch-toxischer Effekt in der
Wahrnehmung des Begriffs „toxisch“ nicht
durch Übertragung auf den gesamten
menschlichen Organismus fehlinterpretiert
werden.
Aus der fluoridbedingten Störung der Ame-
loblastenfunktion resultiert eine Schmelz-
fluorose. Eine typische Schmelzfluorose ist
durch das Auftreten weißlicher Linien oder
Streifen quer über die Zahnkrone gekenn-
zeichnet, die symmetrisch an den gleichen
Zähnen auftreten [DenBesten und Li, 2011].
Die Prävalenz von Fluorosen bei Kindern
und Jugendlichen liegt in Deutschland bei
15 Prozent [Reich und Schiffner, 1999].
Jedoch ist der Ausprägungsgrad der Fluoro-
se weit überwiegend als fraglich und als sehr
milde oder milde Form charakterisiert.
Schwere Formen, die als endemische
Schmelzfluorose in Gebieten mit hohem
natürlichen Fluoridgehalt im Trinkwasser
(vulkanische Böden) beobachtet wurden,
kommen bei Verwendung von Fluorid zur
Kariesprophylaxe nicht vor [DenBesten und
Li, 2011].
Da die Schmelzfluorose die Einschränkung
der normalen Ameloblastenfunktion, meist
in der Phase der Mineralisation, ausweist,
können fluorotische Schmelzveränderun-
gen nur während der Phase der Schmelzbil-
dung entstehen [Bronckers et al., 2009].
Dies betrifft, sofern Weisheitszähne nicht
berücksichtigt werden, die ersten acht
Lebensjahre. Sobald Kinder in den Mund
aufgenommene Flüssigkeiten sicher ausspü-
len können, besteht das Risiko einer Fluoro-
se-Entstehung jedoch nicht mehr. Das ist im
Allgemeinen spätestens mit fünf Jahren der
Fall [Ericsson und Forsman, 1969]. Generell
ist zur Einschätzung des Fluoroserisikos
sowie der Auswahl individuell indizierter
Fluoridierungsmaßnahmen eine Fluorid-
anamnese erforderlich. Die vor dem Hinter-
grund dieser Anamnese empfohlenen Maß-
nahmen erfolgen mit Bezug auf das Karies-
risiko und stellen ein Ausbalancieren von
kariespräventiven Anforderungen und der
Reduktion des Fluorose-Risikos dar.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben
gezeigt, dass bei altersentsprechender
Dosierung die aus Fluoridtabletten aufge-
nommene Fluoridmenge deutlich höher ist
als die aus Zahnpasten aufgenommene
Menge [Hetzer et al., 2003], und dass rund
zwei Drittel der Fluorosefälle auf Fluoridtab-
letten zurückgeführt werden können
[Pendrys, 2000]. In dieser Studie war das
verbleibende Drittel der Fluorosefälle mit
mehr als einmaligem täglichen Zähneput-
zen in den ersten zwei Lebensjahren (Paste
mit 1000 ppm) verbunden. Da mithin die
Fluorose mit größerer Wahrscheinlichkeit
nach systemischer Fluorideinnahme auftritt,
die karieshemmende Wirkung hingegen auf
der lokalen Fluoridwirkung basiert, werden
lokale Fluoridierungsmethoden eindeutig
gegenüber systemischen Maßnahmen be-
vorzugt.
In dem erwähnten Ausbalancieren von
kariespräventiven Anforderungen bei
gleichzeitigem Vermeiden einer Fluorose ist
in begründeten Fällen durchaus auch eine
individuelle Empfehlung, bei Kindern im
Vorschulalter eine höher konzentrierte
Fluoridzahnpaste anzuwenden (zum Bei-
spiel 1000 ppm Fluorid), in Erwägung zu
ziehen. Insgesamt besteht zwischen der
Karieshemmung und dem Fluoridgehalt der
Zahnpaste eine deutliche Dosis-Wirkungs-
Beziehung [Walsh, 2010].
Kommentar aus der
Yellow-Press
Obgleich die Unbedenklichkeit von Fluorid
in den zur Kariesprävention verwendeten
Zubereitungen und Konzentrationen viel-
tausendfach belegt ist, werden dennoch
periodisch wiederkehrend eine Reihe unter-
schiedlicher Vorhaltungen gegenüber Fluo-
rid vorgebracht. Neu in diesem Zusammen-
hang sind Statements, systemisch zugeführ-
tes Fluorid würde sich negativ auf die Intelli-
genz von Kindern auswirken. In gleicher
Weise wird Fluorid mit Verhaltensauffällig-
keiten von Kindern in Zusammenhang ge-
bracht.
Als Beleg für die Assoziationen zwischen
Fluoridgehalt im Trinkwasser und einem ge-
ringeren Intelligenzquotienten der Kinder
wird im Wesentlichen eine Übersichtsarbeit
zitiert, die insgesamt 27 Studien zusam-
menfasst [Choi et al., 2012]. Von diesen
Studien wurden 25 in China und zwei im
Iran durchgeführt. Die natürlichen Fluorid-
gehalte der in den Studienorten verfügba-
ren Trinkwasser schwanken zwischen 0,9
und 11 ppm (Mittel der in den Studien an-
gegebenen Maximalwerte: 4,3 ppm). Bei
den in diesen Gebieten untersuchten Kin-
dern wurde ein um sieben IQ-Punkte gerin-
gerer Intelligenzquotient als in Vergleichs-
gruppen bestimmt. Die Autoren des Review
räumen ein, dass dies innerhalb des Mess-
fehlers der IQ-Bestimmung liege. Allerdings
zeigen fast alle der eingeschlossenen
Diese Abbildung zeigt eine leichte Fluorose.
Fotos: Schiffner
35